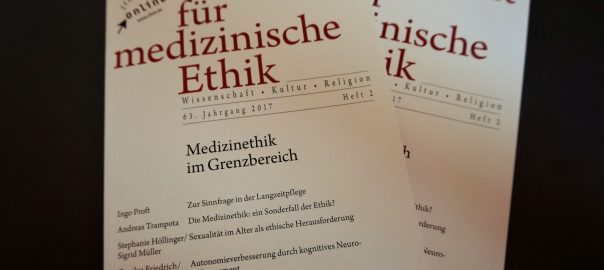„Rückständig, autoritär, moralinsauer“ – so wird die katholische Kirche von vielen Menschen gesehen. Nur zu gerne hält man der Kirche ihr Sündenregister vor. Und das ist lang, keine Frage, wenn man einmal in die 2.000-jährige Kirchengeschichte blickt, wie ich es als studierter Theologe ausführlich getan habe. Mitglieder der Kirche sind nicht per se bessere Menschen, sind nicht automatisch menschlicher und moralischer als andere.
„Glauben und beten kann ich allein im Wald“ – auch das ist eine geläufige Antwort auf die Frage, warum jemand nicht (mehr) in der Kirche ist. Klar, einen irgendwie gearteten Do-it-yourself-Glauben an irgendetwas Transzendentes kriegt man auch bzw. besser ohne Kirche hin.
Warum bin und bleibe ich aber Mitglied der Kirche und das aus voller Überzeugung? Wer nicht nur an irgendeine höhere Macht, sondern konkret christlich glauben will, weil Jesus Christus und seine Botschaft ihn faszinieren, der kommt um die Kirche nicht herum. Im Gegenteil: christlich glauben können wir ohne die Kirche gar nicht. Denn es war die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, die den Glauben von der Zeit der Apostel an über die Jahrtausende hinweg bis zu uns heute weitergegeben hat. Ohne Kirche gäbe es gar keinen Glauben an Jesus Christus und an den Gott, der nach christlicher Überzeugung dreifaltig und die Liebe ist (1 Joh, 4,8).
Der Fakt, dass ich der Kirche den Glauben verdanke, hilft mir auch die anderen vielen positiven Seiten an ihr zu sehen. Schließlich war auch die Kirchengeschichte nicht nur eine mit Schatten-, sondern auch eine mit Lichtseiten. Christliches Menschenbild und christliche Ethik haben beispielsweise auch die Entwicklung zu unseren modernen rechts- und sozialstaatlichen sowie auf den universellen Menschenrechten beruhenden Demokratien maßgeblich mitgeprägt.
In der Kirche findet man nicht nur besagten Glauben an Jesus Christus. Durch die Sakramente, also Taufe, Firmung, Eucharistie, Ehe, Weihe, Beichte und Krankensalbung, die die Kirche als sichtbare Zeichen der Zuwendung Gottes zu uns Menschen versteht, wird dieser Glaube außerdem in allen wichtigen Situationen des Lebenswegs sinnlich erfahrbar.
Die Kirche ist in erster Linie die Gemeinschaft der Glaubenden. Nur für sich alleine glauben ist schwierig. Ich erfahre die Gemeinschaft der Kirche als tragend, gerade auch auf Durststrecken im Glauben. Wer glaubt, ist nicht allein, hat deshalb Papst Benedikt XVI. immer wieder betont. Und es ist einfach schön, wenn man durch andere im gemeinsam geteilten Glauben bestärkt wird oder andere darin stärken kann. Letztlich war dies auch ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung für das Studium der Katholischen Theologie.
Die Gemeinschaft der Kirche ist außerdem viel bunter und vielfältiger, als viele meinen. Es gibt ein reiches Spektrum an theologischen, politischen und liturgischen Positionen im Schoß der einen Mutter Kirche, wie sie traditionell auch genannt wird. Die katholische Kirche ist keineswegs nur ein monolithischer Block. Sie ist keine sektenähnliche „Heilsanstalt“, in der alle, die in sie durch die Taufe „eingewiesen“ wurden, in uniformer Weise und mit Gewissheitsanspruch das Gleiche denken und tun müssen und so mit einer Art Vollkasko-Heilsversicherung durch das Erdental hindurch geradewegs in Richtung Himmel gelenkt werden, während alle anderen ohne Kirche auf diesem Weg steckenbleiben müssen. Die katholische Kirche ist in dieser Hinsicht besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil demütiger und selbstkritischer geworden. Sie kann jetzt auch das viele Gute außerhalb ihrer selbst und die Freiheit des Einzelnen besser wertschätzen.
Diese kirchliche Demut verkörpert der aktuelle Papst Franziskus in besonderer Weise, wodurch viele Menschen wieder einen Zugang oder zumindest ein freundlicheres Bild von der Kirche erhalten haben. Auch ich bin begeistert davon, wie er der Kirche ein solches Gesicht gibt, das zwar beileibe nicht neu ist, für viele Menschen aber verdeckt war, ohne dass der Papst dabei die hohen Ideale des christlichen Glaubens und Lebens verharmlost. Mit der Kirche zu glauben und sich mit ihrer Morallehre auseinanderzusetzen, ist nicht bequem, sondern herausfordernd.
Dieses Herausfordernde kommt auch heute noch manchmal oberlehrerhaft und rigide rüber. Die katholische Morallehre hat zweifellos einen hohen Anspruch, was auch gut ist. Doch auch ich als studierter Theologe bin mir nicht immer sicher, ob so manche Einzelposition dem Hauptgebot der Liebe wirklich gerecht wird. Besonders fasziniert bin ich aber von der katholischen Soziallehre, denn nirgendwo sonst finde ich einen genialeren Mittelweg zwischen politischen Extremen als hier.
Und gerade in der heutigen Zeit ist es für mich besonders wichtig, in einer Weltkirche Mitglied zu sein. Einer Weltkirche, in der Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen vereint sind, was nur ein Grund von vielen ist, warum ein echter Katholik niemals Nationalist oder Fremdenfeind sein kann.
Christen sind nicht per se bessere Menschen. Wer sich als Christ jedoch ehrlich und entschieden auf den christlichen Glauben und seine Ethik einlässt, hat zumindest gute Chancen, einer zu werden. Die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden kann so auch die Welt ein Stückchen besser machen. Der Publizist Andreas Püttmann verweist auf die „millionenfache Wirkung christlicher Ethik auf alltägliche Lebenssituationen, auf Herzen und Gewissen von Menschen, auf soziale Entscheidungen in Familie, Beruf und Gesellschaft, die in kein Geschichtsbuch eingehen.“ Auch ich versuche daher meinen Alltag so gut es einigermaßen geht auf der Basis des christlichen Liebesgebots zu gestalten. Wer mir dabei hilft, ist die Kirche. Deshalb gehöre ich ihr gerne und dankbar an.
Erschienen in Des Friedrichs Wilhelm (fw), Stadt und Campus Magazin des AStA der Universität Bonn, Ausgabe vom 12.06.2017.




 Lars Schäfers, geboren 1988, hat Katholische Theologie an der Universität Bonn studiert. Er arbeitet als Stellvertretender Chefredakteur des Online-Magazins f1rstlife, als Redakteur im Bonner Verlag für Steuern, Recht und Wirtschaft sowie als Freiberufler unter der Marke „Worte mit Wert“.
Lars Schäfers, geboren 1988, hat Katholische Theologie an der Universität Bonn studiert. Er arbeitet als Stellvertretender Chefredakteur des Online-Magazins f1rstlife, als Redakteur im Bonner Verlag für Steuern, Recht und Wirtschaft sowie als Freiberufler unter der Marke „Worte mit Wert“.